


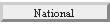





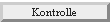



|
Schulgesetz für Berlin (SchulG)
§ 18
[Entgeltfreihaeit und Kostenbeteiligung]
(1) Der Besuch der Berliner Schule ist unentgeltlich. Die Schulgeldfreiheit erstreckt sich auf
den Unterricht und die sonstigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule gemäß
§12 sowie den Besuch der Vorklassen gemäß § 8 Abs.1 und 2.
Auch freiwillige Veranstaltungen können im Rahmen der Bildungsziele der Schule unentgeltlich
angeboten werden.
(2) Für außerunterrichtliche Betreuungszeiten im offenen Ganztagsbetrieb an Grund-
und Sonderschulen (Primarbereich), die von Erziehern oder in vergleichbarer Funktion tätigen
schulischen Mitarbeitern durchgeführt werden, gilt das Kita- und
Tagespflegekostenbeteiligungsgesetz in der Fassung vom 2. Februar 1994 (GVBl. S.60),
geändert durch Artikel II § 5 des Gesetzes vom 15. April 1996 (GVBl. S.126),
einschließlich der dazu erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend. An Grund- und
Sonderschulen, die keine Betreuungszeiten während der Schulferien anbieten,
wird abweichend von den Regelungen des Kita- und Tagespflegekostenbeteiligungsgesetzes für
zwei Monate im Schuljahr keine Kostenbeteiligung erhoben.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 18a
[Lernmittelfreiheit]
(1) Die für den Unterricht erforderlichen Lernmittel werden den Schülern der
Berliner Schule vom Land Berlin entweder leihweise zur Verfügung gestellt oder unentgeltlich
zu Eigentum überlassen. Das für das Schulwesen zuständige Mitglied des Senats
bestimmt, welche Lernmittel den Schülern übereignet werden. Als Lernmittel im Sinne
des Satzes 1 gelten
- die für die Hand des Schülers bestimmten Schulbücher einschließlich
ergänzender Druckschriften,
- die dem Unterricht dienenden Arbeitsmittel mit Ausnahme solcher Gegenstände,
die von den Schülern üblicherweise auch außerhalb des Unterrichts benutzt
oder von Schülern der Berufsschulen üblicherweise auch für die Berufsausbildung
oder Berufsausübung benötigt werden.
Satz 1 gilt nicht für Schüler, die sich in einer Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes
befinden, hinsichtlich der in Satz 3 Nr. 1 genannten Lernmittel. Die für das Schulwesen zuständige
Senatsverwaltung wird ermächtigt, hierzu besondere Ausführungsvorschriften zu erlassen.
Das für den Unterricht erforderliche Verbrauchsmaterial (zum Beispiel Hefte, Schreibgerät)
kann den Schülern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Es ist unentgeltlich
zur Verfügung zu stellen, wenn die Erziehungsberechtigten des Schülers zur Beschaffung
des erforderlichen Verbrauchsmaterials nicht imstande sind oder wenn die Beschaffung nach
Art und Verwendungszweck des benötigten Verbrauchsmaterials nicht den Schülern oder
Erziehungsberechtigten überlassen werden kann.
(2) Zur Gewährleistung der Lernmittelfreiheit sind die Bezirke verpflichtet,
von den ihnen zugewiesenen Finanzmitteln für die Schulen einen Betrag zu verwenden,
der mindestens den für die einzelnen Schularten und -formen festgelegten Mindeststandards
für die Beschaffung von Lernmitteln je Schüler entspricht. Die Mindeststandards
werden durch die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung im Benehmen
mit der Senatsverwaltung für Finanzen festgesetzt. Die Finanzmittel sollen den Schulen
auf Antrag zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden.
(3) Zur Sicherung von Unterricht und Erziehung, der notwendigen Ausstattung und
des ordnungsgemäßen Betriebes der Schulen sowie zur Förderung
der Eigenverantwortung der Schulen sollen die Bezirke auf Antrag die von ihnen
veranschlagten Finanzmittel
- für Lehrmittel und Unterrichtsmaterial,
- zur Durchführung schulischer Veranstaltungen, für die Ausstattung
mit Schul- und Hausgeräten (konsumtive und investive Beschaffung) sowie
für Informations- und Kommunikationstechnik,
- für kleine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie Geschäftsbedarf
den Schulen zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung stellen.
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für vom Landesschulamt unterhaltene Schulen
entsprechend.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 19
[Koedukation]
Schüler und Schülerinnen werden gemeinsam erzogen und unterrichtet, soweit
nicht besondere Umstände eine Trennung notwendig machen.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 20
[Schulgesundheitspflege, Schulsport]
(1) Durch planvolle Gesundheitspflege unter ständiger ärztlicher Überwachung
und durch Leibesübungen ist für eine gesunde körperliche Entwicklung der Jugend
zu sorgen.
(2) Ärztliche und zahnärztliche Reihenuntersuchungen, die im Rahmen
der Schulgesundheitspflege stattfinden, gelten als verbindliche Veranstaltungen der Schule
im Sinne des § 12 Satz 1. Sie werden im Benehmen mit den Schulen durchgeführt.
(3) Die ärztlichen und zahnärztlichen Aufgaben der Schulgesundheitspflege werden
von den Gesundheitsämtern durchgeführt und unterliegen nicht der Schulaufsicht.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 21
[Schulpsychologischer Dienst]
(1) Die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Berliner Schule wird durch den Schulpsychologischen
Dienst unterstützt. Seine Tätigkeit umfaßt insbesondere
- Untersuchung und Beratung sowie betreuende Maßnahmen bei Lernschwierigkeiten und
Verhaltensstörungen von Schülern,
- Mitwirkung in Fragen der Einschulung, Umschulung und Schullaufbahn,
- Mitarbeit bei der Entwicklung und Erprobung von Verfahrensweisen zur therapeutischen Betreuung.
Er kann außerdem im Rahmen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Berliner Schule
Leistungsmessungen in Schülergruppen mit dem Ziel einer objektivierten Leistungserfassung
durchführen.
(2) Untersuchungen, die der Schulpsychologische Dienst zur Vorbereitung von Entscheidungen
nach § 8 Abs.1 und 2, § 9, § 10a sowie § 28 Abs.4, und
Leistungsmessungen nach Absatz 1 Satz 3, die er mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde
durchführt, gelten als verbindliche Veranstaltungen der Schule im Sinne des § 12 Satz 1.
(3) Der Schulpsychologische Dienst ist in die untere Schulaufsichtsbehörde eingegliedert.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 22
[Sexualunterricht]
Der Sexualunterricht gehört zu den Aufgaben der Schule; er wird dem Unterricht
verschiedener Fächer zugeordnet. Ziel des Sexualunterrichts ist es, den Kindern und
Jugendlichen das ihrem Alter und ihrer Reife angemessene Wissen zu vermitteln und
sie zu verantwortlichem Handeln gegenüber sich selbst und den anderen in Familie und
Gesellschaft zu befähigen. Der Sexualunterricht darf zu keiner einseitigen Beeinflussung
führen. Das Erziehungsrecht der Eltern ist zu berücksichtigen, indem diese vor allem
in Elternversammlungen rechtzeitig über Inhalt und Form des Sexualunterrichts informiert werden
und ihnen Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 23
[Erteilung von Religionsunterricht]
(1) Der Religionsunterricht ist Sache der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.
Er wird von Personen erteilt, die von diesen beauftragt werden. Die Kirchen, Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften übernehmen die Verantwortung, daß der Religionsunterricht
gemäß den für den allgemeinen Unterricht geltenden Bestimmungen durchgeführt wird.
Lehrer an öffentlichen Schulen haben das Recht, Religionsunterricht zu erteilen; diese
Unterrichtsstunden werden ihnen auf die Zahl der Pflichtstunden angerechnet. Aus der Erteilung oder
Nichterteilung des Religionsunterrichts dürfen den Lehrern keine Vorteile oder
Nachteile erwachsen.
(2) Religionsunterricht erhalten diejenigen Schüler, deren Erziehungsberechtigte eine
dahingehende schriftliche Erklärung abgeben. Die Willenserklärung gilt bis zu
einem schriftlichen Widerruf. Bei religionsmündigen Schülern tritt die eigene
Willenserklärung bzw. der eigene Widerruf an die Stelle der von den Erziehungsberechtigten
ausgehenden Erklärung. Wer als Erziehungsberechtigter zu gelten hat, entscheidet das Gesetz
über die religiöse Kindererziehung vom 15. Juli 1921 (RGBl. S.939).
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 24
[Eingliederung des Religionsunterrichts]
(1) Die Schule hat für die Erteilung des Religionsunterrichts an die nach § 23 Abs.2
ordnungsgemäß angemeldeten Schüler allwöchentlich zwei Stunden im Stundenplan
der Klassen freizuhalten und unentgeltlich Unterrichtsräume mit Licht und Heizung
zur Verfügung zu stellen. Die nicht zum Religionsunterricht gemeldeten Schüler
können während der Religionsstunde unterrichtsfrei gelassen werden.
(2) Soweit Klassen nicht gebildet werden, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, daß
die Schule durch eine entsprechende Aufteilung des Unterrichtsangebotes den nach § 23 Abs.3
angemeldeten Schülern die Teilnahme an zwei Stunden Religionsunterricht je Woche
zu ermöglichen hat.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 25
[Beteiligungsrechte]
Lehrer, Schüler und Erziehungsberechtigte wirken und bestimmen bei der Durchführung
des Bildungsauftrages der Berliner Schule mit. Das Nähere regelt das Schulverfassungsgesetz.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 26
[Gliederung der Berliner Schule]
(1) Die Berliner Schule gliedert sich in die für alle Schüler gemeinsame Grundschule und
in die Oberschule. Die Oberschule umfaßt die Zweige Hauptschule, Realschule und Gymnasium,
die Gesamtschule sowie die Zweige Fachoberschule, Berufsschule und Berufsfachschule.
Die in diesem Gesetz vorgesehenen Einrichtungen für ausländische Kinder und Jugendliche
(Vorbereitungsklassen, Eingliederungslehrgänge) sind ebenfalls Teil der Berliner Schule.
(2) Zur Berliner Schule gehören auch die Sonderschulen und Sonderschuleinrichtungen. Diese
entsprechen in ihrer Zielsetzung der Grund- oder Oberschule, soweit sich nicht aus ihrer
sonderpädagogischen Aufgabe Abweichungen ergeben.
(3) Geeigneten Berufstätigen ist durch besondere Einrichtungen der Berliner Schule
Gelegenheit zu geben, einen dem Hauptschulabschluß gleichwertigen Bildungsstand zu erreichen.
Für Berufstätige mit Realschulabschluß oder gleichwertiger Schulbildung,
die eine abgeschlossene Berufsausbildung besitzen, können an Fachoberschulen Lehrgänge
in Teilzeitform zum Erwerb der Fachhochschulreife eingerichtet werden. Die in Satz 1 und 2
genannten Einrichtungen und Lehrgänge schließen mit Prüfungen ab.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 27
[Bildungsgang, Notenstufen, Versetzungen, Prüfungen]
(1) Der Bildungsgang gliedert sich
- an der Grundschule und an der Oberschule mit Ausnahme der Oberstufe des Gymnasiums
in aufsteigende Klassenstufen, denen die Schüler in der Regel jeweils für
die Dauer eines Schuljahres angehören (Klassen oder Jahrgangsstufen),
- im Sonderschulbereich in aufsteigende Klassen oder Jahrgangsstufen, soweit sich nicht
aus der sonderpädagogischen Aufgabe Abweichungen ergeben.
(2) Soweit Schülerleistungen durch Noten bewertet werden, ist die nachstehende
Notenskala anzuwenden. Erteilt wird die Note
- "sehr gut" (1), wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße
entspricht,
- "gut" (2), wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht,
- "befriedigend" (3), wenn die Leistung im allgemeinen den Anforderungen entspricht,
- "ausreichend" (4), wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im ganzen
den Anforderungen noch entspricht,
- "mangelhaft" (5), wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch
erkennen läßt, daß die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und
die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können,
- "ungenügend" (6), wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und
selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, daß die Mängel in absehbarer Zeit
nicht behoben werden können.
Werden Leistungen nicht erbracht aus Gründen, die der Schüler zu vertreten hat,
so ist unter Berücksichtigung von Alter und Reife des Schülers zu entscheiden,
ob er die Note "ungenügend" erhält oder die nicht erbrachte Leistung
ohne Bewertung bleibt; Näheres regelt das für das Schulwesen zuständige Mitglied
des Senats. Werden Leistungen nicht erbracht aus Gründen, die der Schüler nicht
zu vertreten hat, insbesondere bei Krankheit, so wird keine Note erteilt.
(3) Die Versetzungen in die Klassenstufen 9 und 10 der Hauptschule, in die Klassenstufen 8
bis 10 der Realschule, des Gymnasiums und der Gesamtschule, in die Einführungsphase und
die Kursphase der gymnasialen Oberstufe sowie in die nächsthöhere Klassenstufe
der Fachoberschule und der Berufsfachschule werden in der Regel jeweils am Ende des Schuljahres
mit Wirkung vom Beginn des folgenden Schuljahres vorgenommen; das gleiche gilt für
den Sonderschulbereich, soweit in diesem den genannten Oberschulzweigen entsprechende
Klassenstufen eingerichtet sind, sowie für die Schule für Lernbehinderte.
(4) Die Entscheidung über die Versetzung eines Schülers soll als pädagogische
Maßnahme den Bildungsgang des einzelnen Schülers mit seiner geistigen Entwicklung
in Übereinstimmung halten und die Leistungsfähigkeit der aufsteigenden Klasse sichern.
Über die Versetzung entscheidet die Klassenkonferenz oder der Jahrgangsausschuß.
Ein Schüler ist zu versetzen,
- wenn seine Leistungen in allen Fächern mindestens mit "ausreichend" bewertet
worden sind oder
- wenn trotz nicht ausreichender Leistungen in einzelnen Fächern zu erwarten ist,
daß er am Unterricht der nächsthöheren Klassenstufe erfolgreich teilnehmen kann;
in der Berufsfachschule und der Fachoberschule muß ferner der Bildungsgang erfolgreich
abgeschlossen werden können. Schüler, die nicht versetzt worden sind, wiederholen
die bisherige Klassenstufe desselben Bildungsgangs. Schüler der Realschule,
der Klassenstufen 7 bis 10 des Gymnasiums, der Fachoberschule oder der Berufsfachschule,
die in derselben Klassenstufe zweimal oder nach Wiederholung einer Klassenstufe in
der nächsten Klassenstufe abermals nicht versetzt worden sind, müssen den bisher
besuchten Zweig der Oberschule verlassen. Schüler, die nach Satz 5 das Gymnasium
verlassen mußten und den Schulbesuch an der Realschule fortsetzen, müssen
die Realschule bereits dann verlassen, wenn sie in derselben Klassenstufe abermals
nicht versetzt werden. Über Ausnahmen von den Bestimmungen der Sätze 5 und 6
entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. Für die Versetzung in die Kursphase
der gymnasialen Oberstufe gelten die Sätze 1 bis 5 und 7 entsprechend.
(5) In allen in diesem Abschnitt vorgesehenen Abschlußprüfungen wird an Hand
ausgewählter Fächer festgestellt, ob und mit welchem Ergebnis der Schüler
das Ziel des Bildungsganges erreicht hat. Für die Prüfungen werden von der
Schulaufsichtsbehörde oder in deren Auftrag Ausschüsse gebildet.
Die Prüfungsgegenstände und Prüfungsanforderungen sind in allen Fächern
auf der Grundlage der Rahmenpläne für Unterricht und Erziehung zu bestimmen.
Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. In Ausnahmefällen
kann die Schulaufsichtsbehörde eine zweite Wiederholung zulassen. Das für
das Schulwesen zuständige Mitglied des Senats wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Prüfungsordnungen zu erlassen, die insbesondere regeln
- Prüfungsfächer sowie Art und Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistungen,
- Berufung, Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsorgane,
- Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfung und einzelne Prüfungsteile,
- Prüfungsverfahren einschließlich des Ausschlusses, der Befreiung oder des Absehens
von der mündlichen Prüfung,
- Einbeziehung von im Unterricht und in besonderen Fällen von außerhalb
des Bildungsganges erbrachten Leistungen, Bewertung von Prüfungsleistungen und
Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung,
- Rücktritt sowie Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Prüfung
bei Versäumnissen, Störungen, Täuschungen oder Leistungsausfällen,
- Folgen des Nichtbestehens der Prüfung und Verfahren bei der Wiederholung
von Prüfungen oder Prüfungsteilen.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 28
[Grundschule]
(1) Die Grundschule umfaßt die Vorklasse und die Klassen 1 bis 6. Für die
Aufnahme in die Vorklasse gilt § 8 Abs.3 entsprechend.
(2) Aufgabe der Vorklasse ist es, das Kind in eine größere Gruppe einzuführen
und die Lernfähigkeit zu fördern, ohne den Unterricht der 1. Klasse vorwegzunehmen.
In die Vorklasse werden Kinder aufgenommen, die am 30. September eines Kalenderjahres
fünf Jahre alt sind, soweit sich bei einer schulärztlichen Untersuchung keine Bedenken
ergeben. Der Besuch der Vorklasse ist freiwillig, soweit sich aus § 9 Abs.1 nichts
anderes ergibt.
(3) Von der 5. Klasse an wird eine Fremdsprache als Pflichtfach gelehrt. Als Fremdsprache
kann Englisch, Französisch, Russisch oder Latein gewählt werden. Die Wahl obliegt
den Erziehungsberechtigten des Schülers.
(4) Schüler der Grundschule, die Lernschwierigkeiten haben, werden durch besondere
pädagogische Maßnahmen zusätzlich gefördert mit dem Ziel, ihnen eine
erfolgreiche Mitarbeit am Unterricht ihrer Klassenstufe zu ermöglichen. Diese zusätzlichen
Fördermaßnahmen sind für Schüler der Klassen 1 bis 6 verbindliche
Veranstaltungen im Sinne des § 12 Satz 1.
(5) Die Schüler der Grundschule rücken jeweils mit Beginn eines Schuljahres in die
nächsthöhere Klassenstufe auf. In Ausnahmefällen kann für Schüler, die
wegen längeren Unterrichtsversäumnisses oder aus anderen Gründen nicht hinreichend
gefördert werden konnten, eine Wiederholung der bisherigen Klassenstufe angeordnet werden.
Die Wiederholung wird von der Klassenkonferenz vorgeschlagen; der Klassenleiter hat
die Erziehungsberechtigten hierüber zu informieren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben. Über die Anordnung der Wiederholung entscheidet die Klassenkonferenz. Über
die Entscheidung ist die Schulaufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 29
[Übergang in die Oberschule]
(1) Die Oberschule schließt mit den Zweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium
sowie der Gesamtschule an die Grundschule an.
(2) Mit dem Aufrücken in die Klassenstufe 7 geben alle Schüler in die Oberschule
über. Die Wahl zwischen den Zweigen Hauptschule, Realschule oder Gymnasium obliegt
den Erziehungsberechtigten des Schülers nach Maßgabe der folgenden Absätze
sowie nach Beratung durch den Kassenlehrer oder Schulleiter; der Schüler ist zuvor zu
hören. Innerhalb der einzelnen Zweige kann der Unterricht entsprechend der Befähigungsrichtung
der Schüler differenziert werden.
(3) Schüler werden nach Maßgabe freier Plätze gemäß den
Organisationsrichtlinien (Richtlinien für die Lehrerstundenzumessung und die Organisation der Berlin der
Schule) in die Oberschule aufgenommen, an der sie angemeldet wurden, sofern sie dort ihre erste Fremdsprache
weiterführen können. Die Aufnahmemöglichkeiten einer Oberschule richten sich nach den organisatorischen
und personellen M&omul;glichkeiten und den pädagogischen Erfordernissen der Einzelschule sowie den gebotenen
schulorganisatorischen Festlegungen des Bezirks. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft das Bezirksamt, in dem
die Schule liegt; für die in § 2 Abs. 6 genannten Schulen trifft diese Entscheidung das Landesschulamt.
(4) Überschreitet die Zahl der Anmeldungen für eine Oberschule deren Aufnahmekapazität, so richtet sich die
Aufnahme der Schüler in die Schule nach folgenden Kriterien mit abgestufter Rangfolge:
- Sprachenfolge (erste und zweite Fremdsprache),
- Fortsetzung einer bereits in der Grundschule begonnenen Ausbildung an einer Schule mit musik- oder sportbetonten Zügen,
- Grundschulgutachten,
- Erreichbarkeit der Schule von der Hauptwohnung unter Berücksichtigung der Lage der Schule zu anderen Oberschulen und
der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.
Die Rangfolge nach den Nummern 2 bis 4 ist erst anzuwenden, nachdem das Kriterium der sozialen Härte (begrenzt auf Fälle
im Umfang von höchstens 10 vom Hundert der vorhandenen Schulplätze) berücksichtigt worden ist. Im Übrigen entscheidet das Los.
(5) An der Gesamtschule soll die Schülerschaft im Hinblick auf die Aufgabe dieser Schulform, den Unterricht der drei Oberschulzweige
zu integrieren, heterogen (mit etwa gleichen Anteilen der entsprechenden Oberschulempfehlungen) zusammengesetzt sein. Deshalb ist Absatz
4 auf die Gesamtschule mit folgenden Ma&szling;gaben anzuwenden;
- Das Kriterium der heterogenen Zusammensetzung geht dem Grundschulgutachten vor.
- Härtefälle werden auf den Anteil der jeweiligen Schülergruppe mit entsprechender Oberschulempfehlung angerechnet.
(6) Bei der Aufnahme der Schüler in Ganztagsschulen sind zusätzlich die sozialen Bedingungen zu berücksichtigen. Deshalb
sind die Absätze 4 und 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Kriterium der sozialen Bedingungen dem Grundschulgutachten (Absatz 4 Nr. 3),
nicht jedoch dem Kriterium der heterogenen Zusammensetzung (Absatz 5) vorgeht. Für den offenen Ganztagsbetrieb gilt dies entsprechend,
wenn die Nachfrage nach solchen Plätzen die Aufnahmemöglichkeiten der jeweiligen Schule übersteigt.
(7) Kann der Schüler nicht gemäß dem Erstwunsch seiner Erziehungsberechtigten in die von ihnen ausgewählte Schule aufgenommen
werden, so sind die Absätze 3 bis 6 auf Zweit und Drittwünsche entsprechend anzuwenden, sofern nach Berücksichtigung der
Erstwünsche noch freie Plätze zu Verfügung stehen. Kann er auch in diese Schulen nicht aufgenommen werden, so wird seinen
Erziehungsberechtigten eine noch aufnahmefähige Schule benannt. Nehmen die Erziehungsberechtigten dieses Angebot nicht wahr, so wird
der Schüler gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 einer Schule zugewiesen.
(8) In die Realschule oder das Gymnasium übergehende Schüler werden zunächst
auf Probe für die Dauer eines Schulhalbjahres aufgenommen. Schüler, die nach
ihren Fähigkeiten und Leistungen für den gewählten Zweig der Oberschule nicht
geeignet sind, müssen nach Ablauf der Probezeit den Zweig wechseln. Über die Eignung
entscheidet die Klassenkonferenz in der Regel frühestens zwei Wochen vor dem Ende
des Unterrichts in der Probezeit; hat der Schüler aus von ihm nicht zu vertretenden
Gründen den Unterricht in einem solchen Ausmaß versäumt, daß eine Entscheidung
nicht möglich ist, kann die Klassenkonferenz beschließen, daß erneut eine
halbjährige Probezeit durchlaufen werden muß. Die Sätze 1 bis 3 gelten
entsprechend für Schüler, die während oder nach der Probezeit in die Realschule
oder das Gymnasium aufgenommen werden, bei einem Wechsel von der Gesamtschule in die Realschule
oder das Gymnasium jedoch nur dann, wenn der Wechsel bis zum Ende des obersten Schulhalbjahres
der Klassenstufe 7 erfolgt. An der Gesamtschule gibt es keine Probezeit.
(9) Bei den Leistungsanforderungen während der Probezeit nach Absatz 3 Satz 1
ist von dem in der Grundschule auf der Grundlage der Rahmenpläne erteilten Unterricht
auszugehen. Die Pläne für Unterricht und Erziehung in den 7. und 8. Klassen
sind einander dergestalt anzugleichen, daß ein Wechsel von einem Zweig der Oberschule
in einen anderen oder zwischen den Zweigen der Oberschule und der Gesamtschule möglich ist.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 30
[Hauptschule]
(1) Die Hauptschule umfaßt die Klassen 7 bis 10. Für den Übergang in die
Klasse 8 gilt § 28 Abs.5 entsprechend. Wer die 9. Klasse erfolgreich
durchlaufen hat, erwirbt den Hauptschulabschluß. Wer die 10. Klasse erfolgreich
durchlaufen hat, erwirbt den erweiterten Hauptschulabschluß. Die mit dem Erwerb
des erweiterten Hauptschulabschlusses erreichte Schulbildung kann von der Schulaufsichtsbehörde
als dem erfolgreichen Abschluß der Realschule gleichwertig anerkannt werden,
wenn festgestellt wird, daß der Bildungsstand des Schülers dem eines Absolventen
der Realschule entspricht.
(2) Wer nach neun Schuljahren nicht in die 10. Klasse versetzt worden ist, kann im Rahmen
der Aufnahmekapazität in dem gewählten Berufsfeld in einen Lehrgang im Sinne
des § 39 Abs.8 aufgenommen werden. Übersteigt die Zahl der Bewerber für
einen Lehrgang im Sinne des § 39 Abs.8 die im Land Berlin für das betreffende
Berufsfeld insgesamt zur Verfügung stehende Aufnahmekapazität, werden zunächst
die Bewerber aufgenommen, die den Hauptschulabschluß nicht mehr im nächsten Schuljahr
erwerben können; bei gleichen Voraussetzungen entscheidet das Los. § 57 Abs.2
gilt entsprechend.
(3) Die Hauptschule kann längstens bis zum Ablauf des elften Schuljahres besucht werden;
die Klassenkonferenz kann jedoch den Besuch der Hauptschule für ein weiteres Jahr zulassen,
wenn nach Leistungen und Bildungswillen des Schülers zu erwarten ist, daß er dann
den erweiterten Hauptschulabschluß erreichen wird. Wenn der Schüler nach
neun Schuljahren den Hauptschulabschluß nicht mehr innerhalb von zwei Jahren erreichen kann
oder wenn Leistungen und Bildungswille des Schülers den Erwerb des Hauptschulabschlusses
innerhalb von zwei Jahren nicht erwarten lassen, kann die Klassenkonferenz abweichend
von Satz 1 bestimmen, daß der Schüler nur noch ein Jahr in der Hauptschule
verbleiben darf.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Sonderschulen und Sonderschuleinrichtungen,
die in ihrer Zielsetzung der Hauptschule entsprechen. Schüler der Sonderschule für
Lernbehinderte, die im neunten Schuljahr die 9. Klasse erfolgreich durchlaufen haben,
besuchen sodann einen Lehrgang im Sinne des § 39 Abs.8; sie sind vorrangig vor
anderen Bewerbern in einen Lehrgang in einem Berufsfeld ihrer Wahl aufzunehmen. Wer
die Sonderschule für Lernbehinderte nach neun Schuljahren nicht erfolgreich durchlaufen hat,
besucht im zehnten Schuljahr einen berufsvorbereitenden Lehrgang mit Vollzeitunterricht
an der Berufsschule mit sonderpädagogischer Aufgabe. In Ausnahmefällen kann
die Klassenkonferenz den Besuch oder die Wiederholung der 9. Klasse der Sonderschule
für Lernbehinderte im zehnten Schuljahr zulassen; Satz 2 gilt für diese Schüler
entsprechend, sofern sie nach § 14 Abs.3 berufsschulpflichtig sind.
(5) Wer nicht Schüler einer Hauptschule ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat,
kann in einer besonderen Prüfung für Nichtschüler nachweisen, daß sein
Bildungsstand dem eines Absolventen der 9. oder 10. Klasse der Hauptschule entspricht.
Der Bewerber wird zu der Prüfung zugelassen, wenn auf Grund der vorgelegten Zeugnisse,
einer angemessen Vorbereitung und erforderlichenfalls nach dem Ergebnis einer Aussprache mit
ihm anzunehmen ist, daß er die Prüfung bestehen kann. Wer die Prüfung besteht,
besitzt je nach Prüfungsziel eine dem Hauptschulabschluß oder dem erweiterten
Hauptschulabschluß gleichwertige Schulbildung. Im übrigen gilt § 27 Abs.5
entsprechend.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 31
[Realschule]
Die Realschule umfaßt die Klassen 7 bis 10. Wer nicht Schüler einer Realschule ist
und das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann in einer besonderen Prüfung für
Nichtschüler nachweisen, daß sein Bildungsstand dem eines Absolventen der Realschule
entspricht; § 30 Abs.5 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 32
[Gymnasium]
(1) Das Gymnasium umfaßt die Klassen 7 bis 10 sowie die Oberstufe. Es wird eine
zweite Fremdsprache als Pflichtfach unterrichtet. Das Gymnasium gibt dem Schüler Gelegenheit,
die Studierfähigkeit zu erreichen oder sich auf eine sonstige berufliche Ausbildung
vorzubereiten. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
(2) In die Aufbauklassen des Gymnasiums (Klassenstufen 9 und 10) können unmittelbar
nach dem erfolgreichen Besuch der Klassenstufe 8 Schüler der Haupt- und Realschule
übergehen, wenn sie nach Fähigkeiten und Leistungen für den Besuch des Gymnasiums
geeignet sind.
(3) In die gymnasiale Oberstufe in Aufbauform können aufgenommen werden
- Absolventen der Haupt- oder der Realschule, die den Realschulabschluß oder
eine gleichwertige Schulbildung besitzen und nach Fähigkeiten und Leistungen geeignet sind,
- Schüler der Berufsfachschule, die den Realschulabschluß oder eine gleichwertige
Schulbildung besitzen und nach Bildungsgang, Fähigkeiten und Leistungen geeignet sind.
(4) Die Oberstufe gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase, in der
die Schüler überwiegend noch im Klassenverband unterrichtet werden, und ein
zweijähriges System von Grund- und Leistungskursen, die sich nach Umfang und Anforderungen
unterscheiden (Kursphase).
(5) Die Einführungsphase führt in die besondere Arbeitsweise der Oberstufe ein.
Für die nach Absatz 3 aufgenommenen Schüler ist sie zugleich Probezeit. Die
Kursphase soll den Schülern durch Wahl der Leistungsfächer und anderer
Unterrichtsfächer ermöglichen, Schwerpunkte zu setzen und sich mit einzelnen
Sachgebieten vertieft zu befassen; durch Unterrichts- und Prüfungsverpflichtungen in
den Aufgabenfeldern und innerhalb der Aufgabenfelder in bestimmten Fächern ist eine
für alle Schüler gemeinsame wissenschaftsorientierte Grundbildung zu sichern.
Die Wahlmöglichkeiten sind beschränkt durch pädagogische Schwerpunkte und
organisatorische Gegebenheiten der einzelnen Schule.
(6) Das für das Schulwesen zuständige Mitglied des Senats wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung weitere Regelungen über den Bildungsgang in der Oberstufe zu treffen,
insbesondere über
- Aufnahme in die Oberstufe einschließlich einer Höchstaltersgrenze, der
Festsetzung von Aufnahmeprüfungen und einer Probezeit in besonderen Fällen,
- Höchstverweildauer in der Oberstufe,
- Wiederholung und Überspringen der Einführungsphase sowie Versetzung in
die Kursphase,
- Ziel und Organisation der Einführungsphase und der Kursphase,
- Einrichtung von Fächern und Kursen sowie ihre Zuordnung zu Aufgabenfeldern,
- Wahlverpflichtungen und Wahlmöglichkeiten in der Kursphase einschließlich
des Verfahrens und der Verpflichtung zur Wiederholung von nicht erfolgreich durchlaufenen
Kurshalbjahren,
- Leistungsbewertung durch Noten und Punkte,
- Erwerb des Latinums und Graecums.
Für die Oberstufe des Französischen Gymnasiums (Collège Français) und
der John-F.-Kennedy-Schule (Deutsch-Amerikanische Gemeinschaftsschule) können dabei
besondere Regelungen getroffen werden, soweit es die organisatorischen oder pädagogischen
Bedingungen dieser Schulen erfordern.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 33
[Erwerb der allgemeinen Hochschulreife]
(1) Der Schüler hat die allgemeine Hochschulreife erworben, wenn er in dem erforderlichen
Umfang am Unterricht der gymnasialen Oberstufe teilgenommen und in der Kursphase und in
der Abschlußprüfung (Abitur) die in der Prüfungsordnung geforderten Leistungen
erbracht hat; abweichend von § 27 Abs.2 Satz 2 Nr.4 entsprechen nur glatt
ausreichende Leistungen den Anforderungen.
(2) Die allgemeine Hochschulreife kann auch Personen zuerkannt werden, die nicht Schüler
eines Gymnasiums sind, wenn sie in einer besonderen Prüfung für Nichtschüler
einen dem Abschluß des Gymnasiums entsprechenden Bildungsstand nachweisen. Zu dieser
Prüfung wird ein Bewerber zugelassen, wenn auf Grund der vorgelegten Zeugnisse,
einer angemessenen Vorbereitung und erforderlichenfalls nach dem Ergebnis einer Aussprache
mit dem Bewerber anzunehmen ist, daß er die Prüfung bestehen kann; § 27 Abs.5
gilt entsprechend. Der Bewerber darf in der Regel nicht vor Vollendung des 19. Lebensjahres
zugelassen werden.
(3) Wer die für bestimmte Studiengänge oder Qualifikationen im Hochschulbereich
notwendigen Latein-, Griechisch- oder Hebräischkenntnisse nicht anders nachzuweisen vermag,
kann eine Ergänzungsprüfung ablegen. Zu dieser Prüfung werden Bewerber zugelassen,
die entweder zum Abitur zugelassen sind oder die allgemeine Hochschulreife besitzen,
sofern sie sich hinreichend auf die Prüfung vorbereitet haben; § 27 Abs.5 gilt
entsprechend.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 34 (gestrichen)
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 35
[Gesamtschule]
Die Gesamtschule umfaßt die Klassenstufen 7 bis 10. In der Gesamtschule wird der Unterricht
der Oberschulzweige Hauptschule, Realschule und Gymnasium mit dem Ziel integriert, daß
eine Entscheidung über die erreichte Schulbildung auf Grund der Leistungen des Schülers
am Ende der 10. Klasse erfolgt.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 35a
[Unterricht für Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache]
(1) Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache werden grundsätzlich mit allen anderen
Schülern gemeinsam unterrichtet, soweit sich aus § 15 oder aus den
Absätzen 2 bis 4 nichts anderes ergibt.
(2) Schüler, die die deutsche Sprache gar nicht oder so wenig beherrschen, daß
sie dem Unterricht nicht oder nicht ausreichend folgen können, werden in Förderklassen
zusammengefaßt, wenn eine ausreichende Förderung in Regelklassen nicht möglich ist.
In diesen Klassen sind die Schüler auf den Übergang in eine Regelklasse vorzubereiten.
Die Entscheidung über die Zuordnung zu einer Klassenstufe oder einer Schulart erfolgt
nach Durchlaufen der Fördermaßnahme.
(3) Bei Seiteneinsteigern erfolgt die Entscheidung über die Zuordnung zu einer Klassenstufe
unter Berücksichtigung der Vorbildung und der Kenntnisse in der deutschen Sprache durch
die Schulleitung. Wenn eine Mitarbeit in der entsprechenden Klassenstufe ihres Alters nicht
zu erwarten ist, können sie in eine bis zu zwei Klassenstufen niedrigere Klassenstufe
aufgenommen werden oder zunächst in eine Förderklasse.
(4) Die Kenntnisse in der deutschen Sprache der Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache
können bei der Aufnahme in die Berliner Schule durch die Schulleitung oder durch von
ihr beauftragte Lehrkräfte festgestellt werden.
(5) In der Berliner Schule sollen für deutschsprachige Schüler und Schüler
nichtdeutscher Herkunftssprache gemeinsame bilinguale Angebote gemacht werden. Die Umsetzung
dieser Regelung steht unter dem Vorbehalt der organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten
des Landes Berlin.
(6) In der Grundschule und in der Hauptschule können Schüler nichtdeutscher
Herkunftssprache auf Antrag von der Teilnahme am Unterricht in der ersten Fremdsprache
befreit werden; ihnen soll in entsprechendem Umfang zusätzlicher Unterricht in Deutsch
erteilt werden. In diesen Fällen ist an der Hauptschule der Erwerb einer
dem Realschulabschluß gleichwertigen Schulbildung und auch der Übergang in
die Realschule oder das Gymnasium ausgeschlossen. Die Möglichkeit zum nachträglichen
Erwerb schulischer Abschlüsse bleibt unberührt. Schüler nichtdeutscher
Herkunftssprache, die in der Grundschule vom Unterricht in der ersten Fremdsprache befreit wurden
und in die Gesamtschule übergehen, müssen ab Klassenstufe 7 in verstärktem
Umfang am Unterricht in Englisch als erster Fremdsprache teilnehmen.
(7) Bei der Berechnung der zurückgelegten Schuljahre im Sinne des § 30 Abs.2
bis 4 sowie des § 39 Abs.7 und 8 wird bei ausländischen Schülern
und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache, die beim Zuzug aus dem Ausland nach Berlin
sieben Jahre oder älter waren, von einem Schulbesuch seit einer im Alter von sechs Jahren
erfolgten Einschulung ausgegangen. Bei ausländischen Schülern und Schülern
nichtdeutscher Herkunftssprache, die in eine niedrigere als ihrem Alter entsprechende Klassenstufe
aufgenommen worden sind, kann die Klassenkonferenz den Besuch der Hauptschule im zwölften
Schuljahr (§ 30 Abs.3 Satz 1 Halbsatz 2) auch dann zulassen, wenn nur
der Hauptschulabschluß erreicht werden kann. Bei ausländischen Schülern und
Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache, denen der Besuch der Hauptschule im zwölften
Schuljahr nach Satz 2 gestattet worden war, kann die Schulaufsichtsbehörde auf Vorschlag
der Klassenkonferenz den Besuch der Hauptschule für ein weiteres Jahr zulassen,
wenn Leistungen und Bildungswille des Schülers erwarten lassen, daß er nunmehr
den erweiterten Hauptschulabschluß erreichen wird.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 36
[Fachoberschule]
(1) Die Fachoberschule vermittelt die für das Studium an einer Fachhochschule erforderliche
Bildung.
(2) Die Aufnahme in die Fachoberschule setzt voraus
- den erfolgreichen Abschluß der Realschule oder eine gleichwertige Schulbildung oder
- die erfolgreiche Beendigung einer Berufsausbildung oder eine mindestens fünfjährige
Berufstätigkeit, sofern der Bewerber den erfolgreichen Abschluß der Hauptschule oder
eine gleichwertige Schulbildung nachweist.
In den Bildungsgang nach Absatz 3 Satz 1 Nr.1 können Bewerber nur bis zum vollendeten 21. Lebensjahr
eintreten; in besonderen Härtefällen können mit Zustimmung der
Schulaufsichtsbehörde auch ältere Bewerber aufgenommen werden. Jeder Bewerber wird
zunächst auf Probe für die Dauer eines Schulhalbjahres aufgenommen. Schüler,
die nach ihren Fähigkeiten und Leistungen für die Fachoberschule nicht geeignet sind,
müssen nach Ablauf der Probezeit diesen Zweig der Oberschule verlassen; erneut in
die Fachoberschule aufgenommen werden darf, wer die Probezeit im Bildungsgang nach Absatz 3
Satz 1 Nr.1 nicht bestanden hatte und nach Abschluß einer Berufsausbildung
die Aufnahmevoraussetzungen für den Bildungsgang nach Absatz 3 Satz 1 Nr.2
erfüllt. Über die Eignung entscheidet die Klassenkonferenz in der Regel frühestens
zwei Wochen vor dem Ende des Unterrichts in der Probezeit.
(3) Der Bildungsgang an der Fachoberschule dauert
- einschließlich einer in ihn eingegliederten praktischen betrieblichen Ausbildung
für die nach Absatz 2 Satz 1 Nr.1 aufgenommenen Schüler zwei Jahre;
mindestens die Hälfte dieser Zeit dient der wissenschaftlich-theoretischen Bildung,
- für Schüler, die nach Absatz 2 Satz 1 Nr.1 aufgenommen werden und
die erfolgreiche Beendigung einer Berufsausbildung oder eine mindestens fünfjährige
Berufstätigkeit nachweisen, ein Jahr,
- für Schüler, die nach Absatz 2 Satz 1 Nr.2 aufgenommen werden,
zwei Jahre.
Für Schüler, deren Schulbildung über die in Absatz 2 Satz 1 Nr.1
geforderte hinausgeht, kann die Dauer des Bildungsganges gekürzt werden, wenn anzunehmen ist,
daß das Bildungsziel der Fachoberschule bereits früher erreicht wird.
(4) Schüler, die nach Absatz 2 Satz 1 Nr.2 in die Fachoberschule aufgenommen worden sind,
besitzen nach erfolgreichem einjährigem Besuch der Fachoberschule eine dem erfolgreichen
Abschluß der Realschule gleichwertige Schulbildung.
(5) Wer in einer Berufsausbildung steht und die nach Absatz 2 Satz 1 Nr.1 oder 2
erforderliche Schulbildung besitzt, kann bereits während der Berufsausbildung in
die Fachoberschule aufgenommen werden. Der Bildungsgang an der Fachoberschule gliedert sich
für die nach Satz 1 aufgenommenen Schüler in einen zwei Schuljahre umfassenden
ersten Abschnitt und in einen zweiten Abschnitt, der die erfolgreiche Beendigung
der Berufsausbildung voraussetzt. Die Teilnahme am Unterricht des ersten Abschnitts gilt nicht
als Erfüllung der Schulpflicht. Der zweite Abschnitt dauert in der Regel für
Schüler mit der in Absatz 2 Satz 1 Nr.1 geforderten Schulbildung ein Schulhalbjahr,
für Schüler mit der in Absatz 2 Satz 1 Nr.2 genannten Schulbildung ein Schuljahr.
(6) Schüler mit der in Absatz 2 Satz 1 Nr.2 geforderten Schulbildung, die nach Absatz 5
Satz 1 in die Fachoberschule aufgenommen worden sind, besitzen nach Beendigung des ersten
Abschnitts des Bildungsganges an der Fachoberschule eine dem erfolgreichen Abschluß
der Realschule gleichwertige Schulbildung.
(7) Als Berufsausbildung oder Berufstätigkeit im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr.2,
des Absatzes 3 Satz 1 Nr.2 und des Absatzes 5 gelten nur solche, die von
der Schulaufsichtsbehörde nach Inhalt und Umfang als zur Vorbereitung eines späteren
Fachhochschulstudiums geeignet anerkannt werden.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 37
[Fachhochschulreife]
(1) In der Abschlußprüfung der Fachoberschule ist festzustellen,
ob der Prüfling die für das Studium an einer Fachhochschule erforderliche Bildung besitzt.
Die Abschlußprüfung wird vor einem Prüfungsausschuß abgelegt. Wer die
Abschlußprüfung der Fachoberschule besteht, erwirbt die Befähigung zum Studium
an einer Fachhochschule (Fachhochschulreife).
(2) Die Fachhochschulreife kann auch Personen zuerkannt werden, die nicht Schüler
einer Fachoberschule sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie eine nach
§ 36 Abs.7 als geeignet anerkannte Berufsausbildung oder hinreichende einschlägige
Berufserfahrung erworben haben und in einer besonderen Prüfung für Nichtschüler
einen dem Abschluß der Fachoberschule entsprechenden Bildungsstand nachweisen. Der Bewerber
wird zu der Prüfung zugelassen, wenn aufgrund der vorgelegten Zeugnisse, einer angemessenen
Vorbereitung und erforderlichenfalls nach dem Ergebnis einer Aussprache mit ihm angenommen
werden kann, daß die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung erfüllt sind;
Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie § 27 Abs.5 gelten entsprechend.
(3) Der erfolgreiche Abschluß einer Berufsfachschule kann von der Schulaufsichtsbehörde
als eine dem erfolgreichen Abschluß der Fachoberschule gleichwertige Schulbildung anerkannt
werden, sofern der Bildungsgang an der Berufsfachschule nach Umfang und Anforderungen so gestaltet
wird, daß er dem an einer Fachoberschule entspricht.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 38
[Anerkennung von Studienbefähigungen und anderen schulischen Leistungsnachweisen]
(1) Die im übrigen Geltungsbereich des Grundgesetzes erworbene allgemeine Hochschulreife
gilt auch im Land Berlin. Sonstige Studienbefähigungen, die im übrigen Geltungsbereich
des Grundgesetzes erworben worden sind, können von dem für das Schulwesen zuständigen
Mitglied des Senats für das Land Berlin anerkannt werden; Rechtsvorschriften, nach denen
bestimmte Prüfungen, bestimmte Laufbahnen oder die Ausübung bestimmter Berufe
die allgemeine Hochschulreife voraussetzen, bleiben unberührt. Für außerhalb
des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erworbene Studienbefähigungen gilt Satz 2
entsprechend mit der Maßgabe, daß die Anerkennung von zusätzlichen
Leistungsnachweisen abhängig gemacht werden kann.
(2) Wer aufgrund einer anderen Studienbefähigung als der allgemeinen Hochschulreife
das Studium an einer deutschen wissenschaftlichen Hochschule aufgenommen und mit Erfolg
abgeschlossen hat, erwirbt mit dem Abschluß die allgemeine Hochschulreife.
(3) Ein sonstiger außerhalb Berlins erworbener schulischer Abschluß kann von
dem für das Schulwesen zuständigen Mitglied des Senats für das Land Berlin
anerkannt werden. Das gleiche gilt für Schulbildungen, die außerhalb Berlins
als einem schulischen Abschluß gleichwertig anerkannt worden sind.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 39
[Berufsschule]
(1) Die Berufsschule vermittelt denjenigen Schülern, die in einem Berufsausbildungsverhältnis
stehen, vor allem die für den gewählten Beruf erforderlichen theoretischen Kenntnisse und
erweitert die Allgemeinbildung in Anknüpfung an die beruflich erworbenen Einsichten und
Erfahrungen. Der Unterricht in der Berufsschule kann entsprechend der schulischen Vorbildung oder
der vorgesehenen Art und Dauer des Ausbildungsverhältnisses der Schüler nach Inhalt und
Anforderungen differenziert werden. Die Berufsschule erteilt ein Abschlußzeugnis, wenn
der Schüler am Ende des ordnungsgemäßen Berufsschulbesuchs das Ziel des jeweiligen
Bildungsganges der Berufsschule durch den Nachweis mindestens ausreichender Leistungen in allen
Unterrichtsfächern erreicht hat. Bei hinreichendem Ausgleich kann in einzelnen Fächern
von den Leistungsanforderungen nach Satz 3 abgesehen werden.
(2) An der Berufsschule beträgt die Zahl der Unterrichtsstunden für Schüler, die
in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen, in der Regel mindestens acht und höchstens
zwölf je Woche; bei mehr als acht Unterrichtsstunden ist der Unterricht möglichst
gleichmäßig auf zwei Tage der Woche zu verteilen. Schüler, die in einem
kaufmännischen oder verwandten Berufsausbildungsverhältnis stehen, werden in der Regel
an zwei Tagen jeder Woche je sechs Stunden unterrichtet.
(3) Das für das Schulwesen zuständige Mitglied des Senats kann auf Antrag
der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände von Amts wegen
eine Vermehrung oder anderweitige Verteilung der in Absatz 2 vorgesehenen Unterrichtsstunden
anordnen. Vor der Anordnung sind die betroffenen Schulen und ihre Fachbeiräte sowie
die zuständige Stelle im Sinne des Berufsbildungsgesetzes zu hören. Berührt
die Anordnung den Aufgabenbereich anderer Mitglieder des Senats, so wird die Entscheidung
im Einvernehmen mit diesen getroffen.
(4) Die Zahl der Unterrichtsstunden darf im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel vermehrt werden, wenn zur Vermittlung des Lernstoffes eine erweiterte
theoretische Durchdringung des Stoffgebietes notwendig ist. Die Zahl von fünfzehn
Unterrichtsstunden darf nicht überschritten werden.
(5) Der Brufsschulunterricht darf anderweitig, insbesondere auf einen oder mehrere Abschnitte
mit Vollzeitunterricht (Blockunterricht) verteilt werden, wenn hierdurch eine Steigerung
der Unterrichtsqualität zu erwarten ist oder eine zeitliche Übereinstimmung mit
der nach § 25 Abs.2 des Berufsbildungsgesetzes festgesetzten Ausbildungsdauer
erreicht wird. Wird Blockunterricht erteilt, so sollen vierhundertachtzig Unterrichtsstunden
je Schuljahr nicht unterschritten werden.
(6) Der Berufsschulunterricht kann abweichend von Absatz 2 im ersten Jahr der Ausbildung
angeboten werden
- als Teilzeitunterricht im Rahmen eines kooperativen Berufsgrundbildungsjahres; dieses
umfaßt einen berufsfeldübergreifenden Lernbereich sowie einen berufsfeldbezogenen
Lernbereich mit fachtheoretischem Unterricht in der Berufsschule und fachpraktischer Ausbildung
in einem Ausbildungsbetrieb oder einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte; die Zahl
der Unterrichtsstunden beträgt mindestens 16 und höchstens 20 je Woche;
oder
- als schulisches Berufsgrundbildungsjahr; dieses wird in Vollzeitform durchgeführt und
umfaßt einen berufsfeldübergreifenden Lernbereich sowie einen berufsfeldbezogenen
Lernbereich mit fachtheoretischem und fachpraktischem Unterricht.
Schülern, die das schulische Berufsgrundbildungsjahr nicht erfolgreich durchlaufen haben,
wird die Wiederholung gestattet, wenn erwartet werden kann, daß sie das schulische
Berufsgrundbildungsjahr erfolgreich wiederholen.
(7) Behinderte Schüler, die durch ein schulisches Berufsgrundbildungsjahr oder durch
einen Lehrgang im Sinne des Absatzes 9 nicht oder nicht hinreichend gefördert werden
können, besuchen nach Beendigung des zehnten Schuljahres einen Lehrgang mit Vollzeitunterricht.
Dieser Lehrgang dauert bis zu zwei Jahren; im zweiten Jahr ist die Teilnahme freiwillig.
(8) Für Schüler, die nach neun Schuljahren nicht in einer allgemeinbildenden
Oberschule verbleiben oder die in einer Sonderschule für Lernbehinderte die 9. Klasse
erfolgreich durchlaufen haben, werden Lehrgänge im zehnten Schuljahr mit Vollzeitunterricht
(berufsbefähigende Lehrgänge) eingerichtet. Diese Lehrgänge sollen
die Allgemeinbildung erweitern und auf die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder
Tätigkeit vorbereiten; die berufsvorbereitenden Ziele der Lehrgänge werden exemplarisch
an den Inhalten eines Berufsfeldes vermittelt. Der erfolgreiche Besuch eines Lehrgangs führt
zu einem dem Hauptschulabschluß gleichwertigen Schulabschluß.
(9) Für Schüler, die nach § 14 Abs.3 berufsschulpflichtig sind,
werden Lehrgänge im elften Schuljahr mit Vollzeitunterricht eingerichtet, die durch
Erweiterung der Allgemeinbildung und Vermittlung beruflicher Grundkenntnisse die Voraussetzungen
für die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit verbessern sollen.
Der erfolgreiche Besuch eines Lehrganges führt je nach Bildungsstand des Schülers
bei Eintritt in den Lehrgang zu einem dem Hauptschulabschluß oder dem erweiterten
Hauptschulabschluß gleichwertigen Schulabschluß.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 40
[Gleichwertigkeitsregelungen im Berufsschulbereich]
(1) Wer den Hauptschulabschluß bisher nicht erworben hat, besitzt eine dem erfolgreichen
Abschluß der Hauptschule gleichwertige Schulbildung, wenn er
- ein schulisches oder kooperatives Berufsgrundbildungsjahr abschließt und
im berufsfeldübergreifenden sowie im fachtheoretischen Unterricht mindestens ausreichende
Leistungen erzielt hat oder
- das Abschlußzeugnis der Berufsschule erwirbt und mindestens die 8. Klasse
einer allgemeinbildenden Oberschule erfolgreich besucht oder die Sonderschule für
Lernbehinderte erfolgreich abgeschlossen hat.
Bei hinreichendem Ausgleich kann in einzelnen Fächern von den Leistungsanforderungen
nach Satz 1 abgesehen werden.
(2) Wer den Hauptschulabschluß erworben hat, besitzt eine dem erweiterten
Hauptschulabschluß gleichwertige Schulbildung, wenn er
- die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr.1 erfüllt oder
- in ein Berufsausbildungsverhältnis mit einer vorgesehenen Ausbildungsdauer von
mindestens zwei Jahren eintritt und in dem Schuljahr, in dem er die Berufsausbildung erfolgreich
beendet, an einer Berufsschule des Landes Berlin sowohl in den allgemeinbildenden als auch
in den fachtheoretischen Fächern mindestens ausreichende Leistungen erzielt;
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Beträgt bei Teilzeitunterricht im Durchschnitt die Zahl
der Unterrichtsstunden an der Berufsschule in der Regel weniger als zwölf je Woche,
so findet Satz 1 nur Anwendung, wenn der Schüler während seiner Berufsausbildung
an der Berufsschule den Besuch zusätzlicher allgemeinbildender Kurse aufnimmt und diese
für die Dauer von zwei Jahren besucht. Einem Berufsschulunterricht im Umfang von in der Regel
mindestens zwölf Unterrichtsstunden je Woche steht es gleich, wenn an der Berufsschule
in entsprechendem Umfang Blockunterricht erteilt wird. Umfaßt der Unterricht
im Berufsgrundbildungsjahr nicht wenigstens zwei Unterrichtsstunden je Woche im Fach Englisch,
so findet Satz 1 nur Anwendung, wenn der Schüler während der gesamten Dauer
des Berufsgrundbildungsjahres einen zusätzlichen Kurs in diesem Fach mit entsprechender
Wochenstundenzahl besucht.
(3) Eine dem erfolgreichen Abschluß der Realschule gleichwertige Schulbildung besitzt, wer
- mit dem erweiterten Hauptschulabschluß in ein Berufsausbildungsverhältnis mit
einer vorgesehenen Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren eintritt oder
- während einer solchen Berufsausbildung durch Besuch eines Abendlehrganges oder
im Wege der Fremdenprüfung einen dem erweiterten Abschluß der Hauptschule
gleichwertigen Bildungsstand erreicht
und in dem Schuljahr, in dem er die Berufsausbildung erfolgreich beendet, an einer Berufsschule
des Landes Berlin sowohl in den allgemeinbildenden als auch in den fachtheoretischen Fächern
mindestens befriedigende Leistungen erzielt. Umfaßt der Berufsschulunterricht nicht wenigstens
zwei Unterrichtsstunden je Woche im Fach Englisch, so findet Satz 1 nur Anwendung,
wenn der Schüler während seiner Berufsausbildung den Besuch eines zusätzlichen Kurses
in diesem Fach mit entsprechender Wochenstundenzahl aufnimmt, diesen für die Dauer von
mindestens zwei Jahren besucht und mit mindestens befriedigenden Leistungen abschließt.
Im übrigen gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.
(4) Als Berufsschulen im Sinne der Absätze 1 bis 3 gelten auch die Sonderschulen
mit entsprechendem Bildungsziel.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 41
[Berufsfachschule]
(1) Die Berufsfachschule übernimmt als Vollzeitschule die Berufsausbildung der Jugendlichen
für die ganze oder einen Teil der vorgeschriebenen oder üblichen Ausbildungszeit.
Sie vermittelt die für den gewählten Beruf erforderlichen praktischen Fertigkeiten
und theoretischen Kenntnisse und erweitert die Allgemeinbildung der Schüler.
Die Ausbildung an der Berufsfachschule schließt mit einer Prüfung ab; dies gilt
nicht für die Ausbildung an der Berufsfachschule für Sozialwesen. Von einer
Abschlußprüfung kann abgesehen werden, wenn sich an die Ausbildung eine Prüfung
im Sinne des Berufsbildungsgesetzes anschließt.
(2) Die Aufnahme in die Berufsfachschule setzt voraus
- bei einem dreijährigen Bildungsgang mindestens den Hauptschulabschluß oder
eine gleichwertige Schulbildung,
- bei einem ein- oder zweijährigen Bildungsgang mindestens den erweiterten
Hauptschulabschluß oder eine gleichwertige Schulbildung.
Sofern für die Ausbildung in einem zweijährigen Bildungsgang der Hauptschulabschluß
oder eine gleichwertige Schulbildung ausreicht, wird eine dieser Arten der Schulbildung für
die Aufnahme vorausgesetzt. Erfordert ein Bildungsgang eine über den erweiterten
Hauptschulabschluß hinausgehende Schulbildung, so wird für die Aufnahme
der Realschulabschluß oder eine gleichwertige Schulbildung vorausgesetzt.
Bei Bildungsgängen, die besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten voraussetzen, kann
die Aufnahme zusätzlich vom Ergebnis einer entsprechenden Eignungsfeststellung abhängig
gemacht werden.
(3) Schüler, die an einem Oberstufenzentrum einen dreijährigen Bildungsgang
der Berufsfachschule besuchen, durchlaufen in von der Schulaufsichtsbehörde zu bestimmenden
Bildungsgängen im ersten Jahr ein schulisches Berufsgrundbildungsjahr; § 39 Abs.6
Satz 1 Nr.2 gilt entsprechend. Ein vor Eintritt in die Berufsfachschule erfolgreich
durchlaufenes schulisches Berufsgrundbildungsjahr ersetzt in einem Bildungsgang
der Berufsfachschule desselben Berufsfeldes das erste Jahr der Ausbildung, sofern der Schüler
die Eintrittsvoraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt.
(4) Der Bewerber wird zunächst auf Probe für die Dauer eines Schulhalbjahres
aufgenommen. Schüler, die nach ihren Fähigkeiten und Leistungen für den
gewählten Bildungsgang nicht geeignet sind, müssen diesen nach Ablauf der Probezeit
verlassen. Über die Eignung entscheidet die Klassenkonferenz frühestens zwei Wochen
vor dem Ende des Unterrichts in der Probezeit.
(5) Wer den erweiterten Hauptschulabschluß bisher nicht erworben hat, besitzt eine
dem erweiterten Hauptschulabschluß gleichwertige Schulbildung, wenn er das erste Jahr
eines Bildungsganges der Berufsfachschule erfolgreich durchlaufen hat. Wer
den Realschulabschluß bisher nicht erworben hat, besitzt eine dem Realschulabschluß
gleichwertige Schulbildung, wenn er
- bei einem Bildungsgang, der den Hauptschulabschluß voraussetzt, zwei Klassenstufen oder
- bei einem Bildungsgang, der den erweiterten Hauptschulabschluß voraussetzt, eine
Klassenstufe
erfolgreich durchlaufen hat.
(6) Für Bewerber mit allgemeiner Hochschulreife oder Fachhochschulreife kann eine bis zu
zweijährige Ausbildung mit Vollzeitunterricht angeboten werden. Für die Probezeit
gilt Absatz 4 entsprechend.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
§ 42
[Oberstufenzentren]
(1) Berufsschulen, Berufsfachschulen und Fachoberschulen werden zu Oberstufenzentren unter
einer gemeinsamen Schulleitung organisatorisch zusammengefaßt; dies gilt nicht für
Berufsschulen mit sonderpädagogischer Aufgabe und für Berufsfachschulen für
sozialpädagogische Berufe. Die einzelnen Oberstufenzentren sind jeweils einem Berufsfeld
oder einem Schwerpunkt eines Berufsfeldes im Sinne der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung
oder sonstiger Vorschriften des Berufsbildungsrechts zuzuordnen. In Oberstufenzentren soll
außerdem eine gymnasiale Oberstufe mit einem berufsfeldorientierten Bildungsangebot
eingerichtet werden, sofern die curricularen Voraussetzungen vorliegen und Unterricht in einem
an dem Berufsfeld orientierten Leistungsfach erteilt werden kann. In die Oberstufenzentren
können auch Fachschulstudiengänge organisatorisch eingegliedert werden.
(2) Berufs- und studienbezogene Bildungsgänge der in Absatz 1 Satz 1 und 3
genannten Oberschulzweige können so miteinander verbunden werden, daß geeigneten
Schülern sowohl die für die Ausübung eines Ausbildungsberufes notwendigen
Fertigkeiten und Kenntnisse als auch die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife
(Doppelqualifikation) vermittelt werden.
(3) Für Oberstufenzentren einzelner Berufsfelder kann das für das Schulwesen
zuständige Mitglied des Senats im Einvernehmen mit dem für Arbeit zuständigen
Mitglied des Senats, sofern bundesrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen, und nach
Anhörung der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie
der zuständigen Stellen im Sinne des Berufsbildungsgesetzes durch Rechtsverordnung bestimmen,
daß Schüler der Berufsschule im ersten Ausbildungsjahr
- den Teilzeitunterricht nur im Rahmen eines kooperativen Berufsgrundbildungsjahres
(§ 39 Abs.6 Satz 1 Nr.1) erhalten, soweit die Voraussetzungen zur Durchführung
der erforderlichen fachpraktischen Ausbildung vorliegen, oder
- an Stelle von Teilzeitunterricht ein schulisches Berufsgrundbildungsjahr
durchlaufen.
(4) Für Schüler, die an einem Oberstufenzentrum die Fachhochschulreife erworben haben,
können durch Rechtsverordnung des für das Schulwesen zuständigen Mitglieds
des Senats Ergänzungslehrgänge zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife vorgesehen werden;
die Ergänzungslehrgänge schließen mit einer Prüfung ab.
(5) Der Besuch eines Oberstufenzentrums setzt die Entscheidung für ein Berufsfeld voraus.
Schüler, die nach § 14 Abs.3 ein schulisches Berufsgrundbildungsjahr, sowie
Schüler, die einen Lehrgang nach § 39 Abs.8 oder 9 zu besuchen haben,
werden wenn sie eine solche Entscheidung nicht getroffen haben, einem Oberstufenzentrum
nach Maßgabe der verfügbaren Plätze unter Berücksichtigung
der örtlichen Nähe zu ihrem Wohnsitz zugewiesen. Soweit Empfehlungen der Berufsberatung
vorliegen, sollen diese in die Entscheidung einbezogen werden.
 Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht
|



